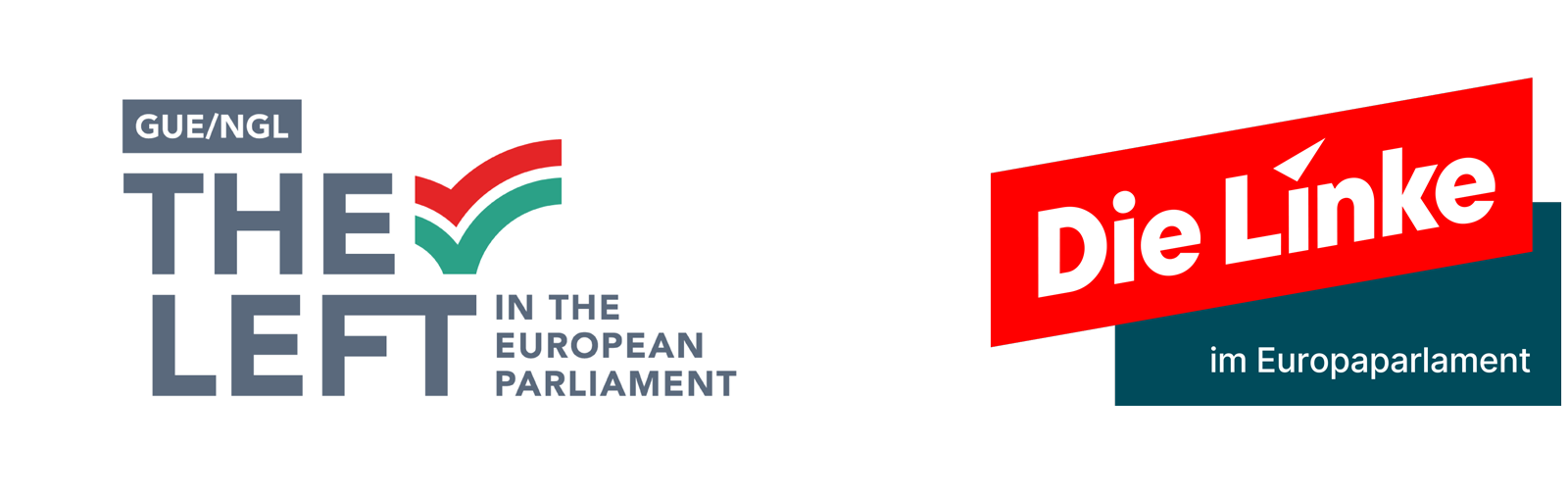Wir begleiten die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU kritisch. Die immer stärkere Tendenz, militärische Instrumente zur Durchsetzung außenpolitischer Ziele einzusetzen, lehnen wir grundsätzlich ab. In der EU-Nachbarschaftspolitik gilt es, die eigenständige Entwicklung und den Ausbau sozialer Standards in den betreffenden Staaten nachhaltig zu unterstützen.
Aktuelle Beiträge zum Thema
Helmut Scholz, handelspolitischer Sprecher von Die Linke im Europaparlament, erklärt zum Trilog-Ergebnis zu den Handelserleichterungen für die Ukraine:
„Der gestern… weiterlesen "Glaubwürdiger Drahtseilakt"
Aussichten für eine Zwei-Staatenlösung für Israel und Palästina. Gibt es sie und wenn ja, wie?
Nora Schüttpelz
Auch im Jahr 75 nach der Staatsgründung Israels und 30 Jahre nach den Osloer Verträgen ist der … weiterlesen "Aussichten für eine Zwei-Staatenlösung für Israel und Palästina. Gibt es sie und wenn ja, wie?"
Das andere Israel – Stimmen progressiver Kräfte der israelischen Opposition in Politik und Gesellschaft
Martina Michels, Nora Schüttpelz
70 Jahre Israel: Kämpfe und Solidarität der Linken in Israel und Europa
Das … weiterlesen "Das andere Israel – Stimmen progressiver Kräfte der israelischen Opposition in Politik und Gesellschaft"
Unsere Schwerpunkte
AA-Z ACTA Afrika Amerikas Argumente Asien Außenbeziehungen BBrexit Bürger*innenrechte CCoronavirus: EU-Krisenreaktion DDie Linke im Europaparlament Digitale Gesellschaft EEP-Linksfraktion THE LEFT EU Asyl- und Flüchtlingspolitik EU Haushalt - mehrjähriger Finanzrahmen Energie-, Klima- und Umweltpolitik Extra-Dossier zur neuen EU-Kommission FFinanzpolitik Friedenspolitik GGemeinsame Agrarpolitik Griechenland Gute Arbeit HHandelspolitik Humanitäre Krise KKonzessionsvergabe - Privatisierungswelle durch die Hintertür? Kultur und Medien LLeichte Sprache Links in EUropa MMediathek PPlenarfokus Pressemitteilungen Presseschau Publikationen RReden Regional- und Strukturpolitik SSoziale Säule Soziales EUropa TTiSA & Co. ZZukunft der EU ÜÜberwachung