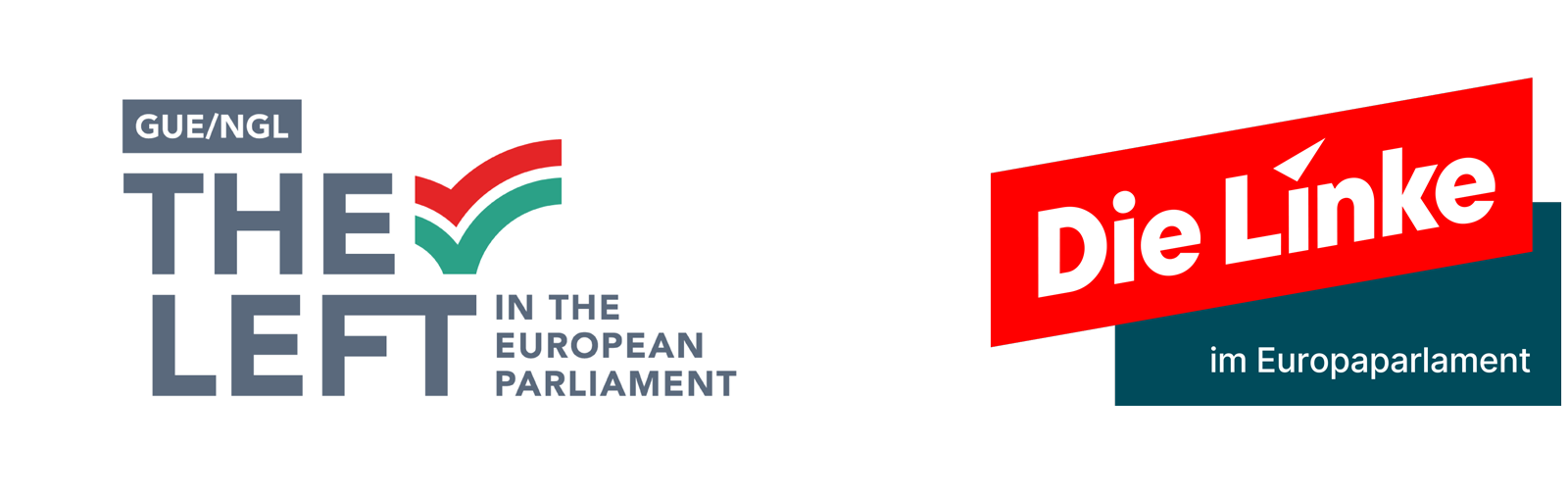Wir wollen fairen Handel umweltweit Lohn-, Sozial- und Umweltdumping zu verhindern und hohe Qualitätsstandards für Konsumgüter und Dienstleistungen zu gewährleisten. Unternehmen müssen für Verstöße gegen diese Standards zur Rechenschaft gezogen werden.
Themen – kurz und knapp
Im Auftrag des EU-Rates, d.h. Mitgliedstaaten der EU verhandelt die EU-Kommission seit einigen Jahren ein umfassendes Freihandelsabkommen mit Kanada. Abgekürzt wird das Abkommen CETA. Kanada, mit einer Bevölkerung von knapp 35 Millionen, ist heute der 12-wichtigste Handelspartner der EU. Das Handelsvolumen beträgt mehr als 61 Milliarden Euro in Waren und 27 Milliarden Euro in Dienstleistungen. Zu Beginn des Jahres 2014 sind die Verhandlungen fast abgeschlossen. Das Abkommen geht weit über reinen Warenaustausch hinaus und enthält explizit Kapitel über Dienstleistungen und deren Erbringung, die Anerkennung von Berufsqualifikationen, das öffentliche Beschaffungswesen, zu Ursprungsregeln, Qualitätsanforderungen, Patentschutz, Niederlassungsbestimmungen, Finanzdienstleistungen, Investitionsschutz, Agrarprodukte-Handel, und zur Nachhaltigkeit der Handelsbeziehungen, d.h. zu Sozial- und Umweltschutzbestimmungen. Zu den umstrittensten Inhalten gehört eine Vereinbarung über die Aufnahme eines Investor-gegen-Staat Klagerechts (ISDS) im entsprechenden Investitionsschutz-Kapitel.
Während diese Bestimmung in den Verhandlungen über ein Abkommen mit den USA (TTIP) in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden, entging es der medialen Aufmerksamkeit weitgehend, dass mit dem CETA erstmals ein solcher Mechanismus in ein von der EU geschlossenes Abkommen aufgenommen würde. Das Kanada-Abkommen wird von Fachleuten in vielen Aspekten als Blaupause und Testballon für das Abkommen mit den USA, aber auch anderen ähnlichen Verträgen gesehen. Dabei argumentiert die Kommission, dass Mitgliedsländer der EU dieses Verfahren in entsprechenden bilateralen Verträgen mit den USA bzw. Kanada mit den USA über das NAFTA-Abkommen bereits verankert hätten.
Viele US-amerikanische Unternehmen verfügen über Niederlassungen in Kanada und beide Ökonomien sind über das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA (Freihandelszone zwischen Kanada, USA, Mexiko) eng verwoben; deshalb wird auch diskutiert, ob das CETA-Abkommen als Hintertür für den Zugang zum EU Markt genutzt werden könnte. In Kanada wird das Abkommen inzwischen breit und kontrovers diskutiert, was mit dazu beitrug, dass die Verhandlungen zu wichtigen Sachthemen trotz politischer Einigung noch nicht final abgeschlossen wurden. Strittig bleiben insbesondere die Bereiche Investitionsschutz und Verlängerung des Patentschutzes für Medikamente, wodurch die Gesundheitskosten in Kanada steigen würden. Wichtig ist auch, dass das CETA-Abkommen erstmalig die Provinzen, die weitgehend autonom auch über ihre Einbeziehung in nationale Vertragspolitiken zu solchen Fragen wie Öffentliches Beschaffungswesen, entscheiden können, explizit mit einbindet und dieser Prozedur zugestimmt haben.
Nach Abschluss der Verhandlungen entscheiden EU-Rat und das Europäische Parlament als Ko-Gesetzgeber über die Ratifizierung.
Die Abgeordneten der Delegation DIE LINKE. im Europaparlament haben den Text des Abkommens geprüft und lehnen CETA ab. Die Aufnahme eines Klagerechts für Investoren gegen Regierungen vor Sondertribunalen (ISDS) ist völlig inakzeptabel und muss zur Ablehnung der Ratifizierung im Europäischen Parlament führen. Die Bewertung des Abkommens erfolgte in enger Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in Kanada. Deren Hauptsorge betrifft den Verlust der Versorgungssicherheit der kanadischen und europäischen Bevölkerung in Folge der Liberalisierung der öffentlichen Beschaffung durch das Abkommen.
Das Patentschutzkapitel würde Generika vom Markt drängen und die Kosten des kanadischen Gesundheitssystems in die Höhe treiben und zugleich legislative Veränderungen im Patenschutz Kanadas erfordern. Ein Klagerecht für Konzerne wird von einer großen Mehrheit der kanadischen Bevölkerung abgelehnt. In Europa hat die französische Regierung bereits dagegen protestiert, dass in den Verhandlungen eine sehr hohe Einfuhrquote für kanadisches Fleisch vereinbart wurde. Sie sieht dadurch die Existenz französischer Bauern gefährdet. Würde das CETA ratifiziert, so wäre nach Einschätzung der Abgeordneten der LINKEN eine wichtige Säule im zunehmend bilateral organisierten, über die WTO-Bestimmungen weit hinausgehenden, Welthandel gesetzt. Das wiederum schafft dann auch einen ernst zu nehmenden, gefährlichen Präzedenzfall für das TTIP Freihandelsabkommen mit den USA.