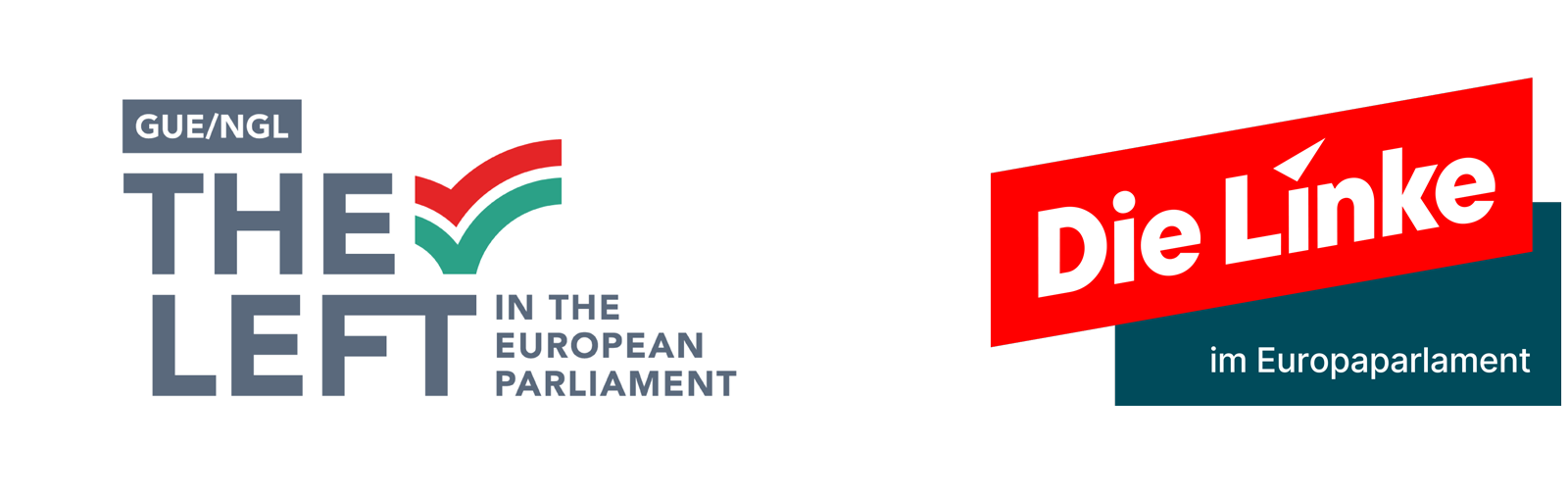Fast 11 Prozent der EU-Bürger:innen sind von Energiearmut betroffen und haben Probleme zu heizen. Steigende Energiekosten verschärfen Armut, auch wegen stagnierender oder fallender Realeinkommen. Angesichts der Klimakrise aber brauchen wir den sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaften.
Themen – kurz und knapp
CCS steht für "Carbon Capture and Storage" - eine Technologie zur Abscheidung und unterirdischen Verpressung von CO2 aus Kraftwerksemissionen.
CCS ist die neue Lösung der Europäischen Union um die klimaschädliche Nutzung fossiler Brennstoffe zu verlängern. CCS steht für "Carbon Capture and Storage" - eine Technologie zur Abscheidung und unterirdischen Verpressung von CO2 aus Kraftwerksemissionen. DIE LINKE.
im Europäischen Parlament lehnt diese Technologie konsequent ab. CCS ist eine Scheinlösung mit Gefahren für Mensch und Umwelt, die unvereinbar ist mit einer ökologischen und sozialen Energiewende.
Anstatt in zukunftsfähige Energien zu investieren, ebnet die EU mit CCS den Weg für die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe in Industrie und Energiewirtschaft und verlängert vor allem die Nutzung von Braunkohle zur Stromversorgung.
Die CCS-Richtlinie aus dem Jahre 2009 bildet europaweit den gesetzlichen Rahmen für die Abscheidung und geologische Speicherung von CO2-Emissionen. Auch in Forschung und Entwicklung legt die EU einen Fokus auf CCS-Technologien, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. So ist die Langzeitsicherheit der unterirdischen Speicherung von CO2 noch völlig ungeklärt. Neben den unverantwortlichen Risiken der CCS-Technik ist die Abscheidung von Kraftwerksemissionen bei der Energiegewinnung zudem extrem teuer, verringert die Energieausbeute um bis zu ein Drittel und schafft ein neues Endlagerproblem. Dennoch hat die EU bis zum Jahre 2020 für CCS-Projekte Fördermittel in Höhe von 13 Milliarden Euro eingeplant, Gelder die besser in zukunftsfähige Energien investiert werden sollten. CCS sichert Energiekonzernen weiterhin Gewinne, indem Emissions-Zertifikaten für die Energiegewinnung aus Kohlekraft eingespart werden können.
Die LINKE. fordert ein Verbot von CCS auf dem gesamten deutschen Bundesgebiet, welches nach einer Ausnahmeklausel in der EU-Richtlinie möglich ist. CCS ist eine gefährliche Scheinlösung, die eine Systementscheidung erfordert: mit Kohlekraft und CCS kann es keine europäische Energiewende geben! CCS birgt hohe Risiken und blockiert eine konsequente Klimaschutzpolitik.
Weitere Themen:
Fracking
Klimaschutz
Umweltpolitik
Europäische Reedereien treiben schmutzige Geschäfte mit Schrottschiffen
Ausgediente Schiffe gelten als gefährlicher Abfall. Asbest, Ölreste und etliche Chemikalien kann man in ihnen finden. Insbesondere an Stränden in Südasien werden Schiffe unter lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen unter nahezu keinen Umweltschutz-Maßnahmen verschrottet. Vergiftete und verdreckte Böden, Strände und Buchten sind die Folge. Die EU hat zwar im Herbst 2013 eine neue Verordnung zum Schiffrecycling erlassen, die für Schiffe unter EU-Flagge ein Abwracken in von der Kommission genehmigten Betrieben vorschreibt. Diese ist jedoch im entscheidenden Punkt zahnlos, da drei Viertel der Schiffe europäischer Eigner, die in Südasien verschrottet werden, schon heute unter einer Nicht-EU-Flagge fahren gilt für sie diese Verordnung nicht. Als LINKE fordern wir daher endlich ein finanzielles Anreiz- oder Pfandsystem für Schiffe einzuführen. Dies soll sicherstellen, dass Schiffseigner nur noch in nachhaltigen Anlagen verschrotten, weil sie sonst einen Pfandbetrag, den sie beim Erwerb des Schiffes zahlen mussten, nicht zurückbekommen.
Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlage muss mehr zählen als kurzfristige Profitinteressen. Ob es um die Bekämpfung des Klimawandels, die biologische Vielfalt, den Umgang mit Ressourcen oder den Verbraucherschutz geht: nach wie vor werden in der EU die Gewinne von Konzernen vor die Zukunft von Mensch und Umwelt gestellt. Die Europaabgeordneten der LINKEN treten dafür ein, dass die Erfordernisse des Umweltschutzes in allen Bereichen des politischen Handelns der EU eine entscheidende Rolle spielen. Wir fordern, dass bei Abwägung von Wirtschaftsinteressen und Naturschutzbelangen der Umweltschutz in allen Bereichen der EU ausreichend berücksichtigt wird.
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Umweltpolitik in der EU immer mehr an Bedeutung gewonnen. So haben mittlerweile die meisten deutschen Gesetze zum Umweltschutz ihren Ursprung in Brüssel. Dazu gehört eine Fülle von Richtlinien und Verordnungen, zu deren Schwerpunkten Richtlinien zur Reinhaltung der Luft, zur Reinhaltung des Wassers sowie Regelungen in den Bereichen Abfallpolitik und Natur- und Artenschutz gehören. Dabei gilt der Grundsatz der Subsidiarität, der sicherstellen soll, dass politische Entscheidungen in der EU so bürgernah wie möglich getroffen werden. Die Mitgliedstaaten der EU sollen, auch auf lokaler/regionaler Ebene soweit wie möglich selbst Schwerpunkte setzen und eigenverantwortlich handeln können. Zur Aufgabe der EU gehört es, zu überprüfen, ob die Mitgliedstaaten die Vorgaben europäischer Rechtsakte erfüllen. Dies ist besonders in der Europäischen Umweltpolitik von Bedeutung, da hier die Mitgliedstaaten die eingegangen Verpflichtungen in vielen Fällen ungenügend ausführen. Die Zahl der Vertragsverletzungsverfahren ist in der Umweltpolitik so hoch wie in sonst keinem anderen Politikbereich der EU.
Seit 1974 bilden die so genannten Umweltaktionsprogramme den Rahmen für die EU-Umweltpolitik, bestimmen Ziele und legen Schwerpunkte der Gesetzgebung fest. Das gegenwärtig laufende siebte Programm für den Zeitraum 2013 bis 2020 beschäftigt sich z.B. mit dem Übergang zu einer „grünen“ Wirtschaft, der Nachhaltigkeit von Städten in der EU und den ökologischen Auswirkungen des EU-Haushaltes.
Die EU ist aufgefordert politische Antworten gegen die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage zu finden und dem drastischen Verlust der biologischen Vielfalt in Europa Einhalt zu bieten. Dabei ist die Umweltpolitik der EU zahlreichen Lobbyinteressen ausgesetzt. Um Märkte und Profite zu sichern übt die Industrie, meist erfolgreich, einen großen Einfluss auf die europäische Gesetzgebung aus – die Umwelt und die Gesundheit der Menschen werden untergeordnet. Auch bestehende Umweltgesetze geraten dabei unter Druck. In den letzten Jahren führten Vorhaben zum Abbau von Bürokratie zu einer Deregulierung auf Kosten des Umweltschutzes, so zum Beispiel im Zuge des REFIT-Programmes der EU-Kommission (Regulatory Fitness and Performance Programme) zur Vereinfachung von Rechtsvorschriften.
Mit dem Ziel bedrohte Lebensräume in Europa zu erhalten und den Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten hat die EU „Natura 2000“ geschaffen, ein europaweites Netzwerk von Naturschutzgebieten. Es besteht aus Gebieten, die durch die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie) und die Vogelschutzrichtlinie als besonders schützenswert ausgewiesen werden. Auch wenn „Natura 2000“ das größte ökologische Netzwerk der Welt ist, gibt es erhebliche Defizite in der Umsetzung. Die EU muss sich an Maßnahmen für zur Umsetzung von Natura 2000 stärker beteiligen und Umsetzungsdefizite in den Mitgliedsstaaten ahnden. DIE LINKE fordert die Stärkung des »Natura 2000«-Schutzgebietsnetzes auf dem Land und im Meer.
Wir streiten für eine konsequente Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Ziel den ökologischen Zustand der Gewässer in Europa zu verbessern, verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten dazu, Pläne zur Regulierung und Überwachung der Qualität von Oberflächengewässer aufzustellen. Um die Umweltqualität von Gewässern prüfen zu können beinhaltet die Richtlinie auch eine Liste von sogenannten prioritären Stoffen, darunter eine Reihe von Pflanzenschutzmitteln oder Industriechemikalien, deren Eintrag reduziert werden muss.
Die Belastung der Meere und Küstengewässer muss durch höhere Anforderungen an die Schiffskonstruktion und an die Sicherheit des Seeverkehrs reduziert werden. Außerdem fordern wir eine umweltfreundliche Schiffsabfallentsorgung unter guten Arbeitsbedingungen, nicht nur in Europa sondern weltweit. Gleichzeitig muss energisch gegen die Überfischung der Meere und besonders zerstörerische Fischereipraktiken, wie die Grundschleppnetzfischerei vorgegangen werden.
Im Rahmen der Luftreinhaltepolitik hat die EU hat für Emissionen und bestimmte Luftschadstoffe sowohl verbindliche als auch unverbindliche Grenzwerte festgelegt. Diese sind völlig unzureichend und müssen dringend verschärft werden. Ebenso muss die EU besser sicherstellen, dass Luftqualitätsstandards in den Mitgliedstaaten eingehalten werden.
DIE LINKE. im EP setzt sich außerdem für europaweit verbindliche Regelungen zum Bodenschutz und das Gelingen der EU-Bodenschutzrichtlinie ein. Seit 2006 wird der Kommissionsvorschlag zur Bodenrahmenrichtlinie im Ministerrat, maßgeblich auch von Deutschland blockiert und könnte nun dem REFIT-Programm zum Opfer fallen.
Die Abfallrahmenrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten der EU dazu Programme für die Vermeidung von Abfall aufzustellen. DIE LINKE. im EP fordert eine ökologische Umgestaltung der Abfallverwertung in Europa mit dem Ziel einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Dazu gehören die Abfallvermeidung, die ökologische Verantwortung von Produktherstellern und eine kommunale und umweltverträgliche Weiterverwertung von Abfällen. Mülltourismus muss unterbunden werden und schrittweise aus der Müllverbrennung ausgestiegen werden. Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Abfällen ist auch eine Frage des Ressourcenschutzes und des nachhaltigen Konsums.
Besonders katastrophal ist das hinter verschlossenen Türen ausgehandelte transatlantische Handels- und Investitionsabkommen (TTIP). Das Abkommen über eine Freihandelszone zwischen der EU und den USA zielt darauf ab Handelshemmnisse abzubauen – auf diese Weise wird die gesamte umweltpolitische Regulierung zu Gunsten von Konzernen in Frage gestellt.
Die EU orientiert sich, besonders in den letzten Jahren an einem fast uneingeschränkten Wachstum - der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage muss dabei hinten anstehen. Wir fordern Alternativen zu einem Wachstumsmodell, das auf soziale Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung setzt. DIE LINKE. im EP verbindet ökologisches Wirtschaften mit sozialer Gerechtigkeit. Europa braucht eine Entwicklung, die Jeder und Jedem einen sozialen und ökologisch nachhaltigen Lebensstil ermöglicht. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Umweltorganisationen kämpft DIE LINKE. im Europäischen Parlament weiterhin für eine europäische Umwelt- und Verbraucherschutzpolitik, die sich an den Menschen und nicht an kurzfristigen Profitinteressen der Konzerne orientiert! Die Europaabgeordneten der LINKEN. werden sich auch in Zukunft dafür einsetzen, in der EU die Weichen zu stellen für den besseren Schutz von Boden, Wasser, Luft und biologischer Vielfalt und für einen konsequenten Klimaschutz einstehen.